Aktuell machen Gerüchte über die Planung einer Executive Order der US-Administration zum Thema Open Access die Runde: Wie das Blog The Scholarly Kitchen berichtet, soll eine Verordnung in Arbeit sein, die die US-Behörden verpflichten würde, eine „zero embargo“ Open-Access-Policy umzusetzen. Eine Executive Order ist eine Durchführungsverordnung der US-Regierung, die ohne weitere Abstimmungen im Kongress rechtlich bindend verankert werden kann.

Die aktuelle Policy der US-Regierung aus dem Jahr 2013 sieht eine Embargoperiode von 12 Monaten vor (PDF). Sie gilt für die forschenden und forschungsfördernden Behörden in den USA wie z. B. die Weltraumbehörde NASA und die National Institutes of Health (NIH). Eine Übersicht der Implementierungen dieser Policy in den einzelnen US-Behörden bietet Science.gov.
Gestern hat nun die Association of American Publishers (AAP) einen offene Brief veröffentlicht, der von über 125 Fachgesellschaften und Verlagen (u. a. Elsevier und Wiley) unterzeichnet wurde und vor der Verankerung einer solchen Open-Access-Policy warnt. In einer begleitenden Pressemitteilung des Verlagsverbandes AAP heißt es:
„In a new major letter signaling deep concern, more than 125 organizations – representing publishers in scientific and medical societies, global companies, and the U.S. Chamber of Commerce – have expressed their strong opposition to a proposed Administration policy that would mandate immediate free distribution of peer-reviewed journal articles reporting on federally funded research.“
In dem offenen Brief (PDF) schildern die Verlage und verlegerisch tätigen Fachgesellschaften ihre Bedenken gegen das Vorhaben:
„Going below the current 12 month “embargo” would make it very difficult for most American publishers to invest in publishing these articles. As a consequence, it would place increased financial responsibility on the government through diverted federal research grant funds or additional monies to underwrite the important value added by publishing. In the coming years, this cost shift would place billions of dollars of new and additional burden on taxpayers. In the process, such a policy would undermine American jobs, exports, innovation, and intellectual property.“
In der Pressemitteilung findet sich die völlig absurde Behauptung, dass im aktuellen wissenschaftlichen Publikationssystem keine Kosten für die/den Steuerzahler*in anfallen:
„Hundreds of non-profit and commercial publishers across America make significant investments, at no cost to taxpayers, to finance the peer-review, publication, distribution, and long-term stewardship of these articles.“
Dabei sind die steuerfinanzierten US-Behörden zentrale Kunden der Verlagsdienstleistungen.
Interessanterweise wird in dem Schreiben der Verlage auch der Umgang mit Forschungsdaten adressiert. Dazu stellen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Briefes fest:
„We write to express our strong opposition to this proposal, but in doing so we want to underscore that publishers make no claims to research data resulting from federal funding.“
Auch wurde ein Brief (PDF) des US-Senator Thom Tillis (R-NC), Chairman of the Senate Judiciary Intellectual Property Subcommittee, an die US-Administration veröffentlicht, in dem dieser seine Bedenken gegen das Vorhaben äußert.
Dass mit der Herausgabe von Open-Access-Zeitschriften und so mit den Bedingungen einer „zero embargo“ Open-Access-Policy durchaus Geld zu verdienen ist, wie viele Open-Access-Verlage beweisen, unterschlagen die Verlage in ihrer Positionierung völlig. Auffallend ist auch, dass der Verlag Springer Nature, der sich selbst als „largest OA publisher“ bezeichnet, das Schreiben nicht unterzeichnet hat. Auch die wohl größte Fachgesellschaft in den USA, die American Association for the Advancement of Science (AAAS), trägt das Schreiben nicht mit.
In der sogenannten “cOAlition S” arbeiten bereits einige Forschungsförderer, u. a. die Europäischen Kommission, der Europäischen Forschungsrat (ERC) und die Weltgesundheitsorganisation WHO, an der Umsetzung einer „zero embargo“ Open-Access-Policy namens “Plan S”, die ab 2021 in Kraft treten wird. Mittelempfängerinnen und -empfänger dieser Förderorganisationen müssen ab dem 01.01.2021 Ergebnisse aus geförderten Projekten in offen zugänglichen Open-Access-Zeitschriften oder -Repositorien unter „zero embargo“-Bedingungen veröffentlichen.
Es bleibt spannend! Jedoch: Gerücht ist Gerücht und nicht mehr!
 Mit der “Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg” (
Mit der “Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg” ( Bemerkenswert ist, wie tief die Forderung nach
Bemerkenswert ist, wie tief die Forderung nach 
 Interessant ist, das die Strategieschrift durch eine Online-Umfrage unterfüttert wurde. Nach dieser sprechen sich 65,9 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer für einen verstärkten Ausbau kostenfreier Zugänge zu Forschungsarbeiten aus. Unter den befragten Studierenden sprechen sich sogar 85,2 Prozent für die Förderung von Open Access aus.
Interessant ist, das die Strategieschrift durch eine Online-Umfrage unterfüttert wurde. Nach dieser sprechen sich 65,9 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer für einen verstärkten Ausbau kostenfreier Zugänge zu Forschungsarbeiten aus. Unter den befragten Studierenden sprechen sich sogar 85,2 Prozent für die Förderung von Open Access aus.

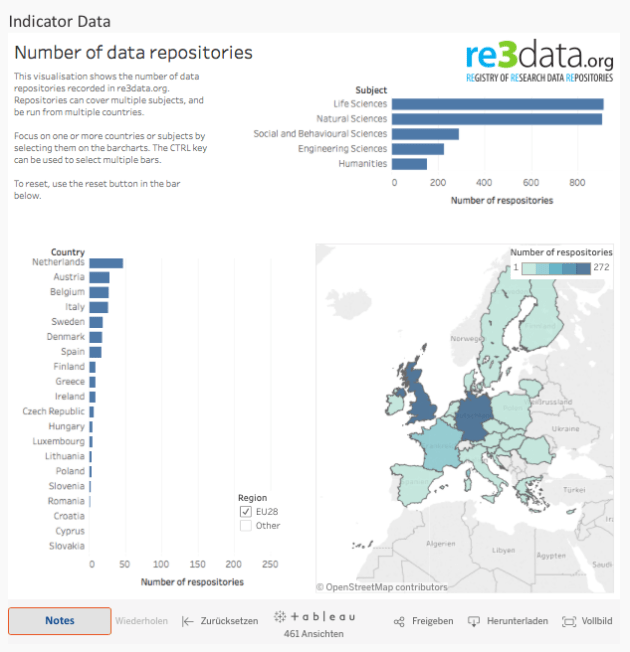
 Passend zum Thema Metriken für Open Science hat heute die „Expert Group on Altmetrics“, die die Generaldirektion Forschung und Innovation der EU-Kommission berät, ihren
Passend zum Thema Metriken für Open Science hat heute die „Expert Group on Altmetrics“, die die Generaldirektion Forschung und Innovation der EU-Kommission berät, ihren